
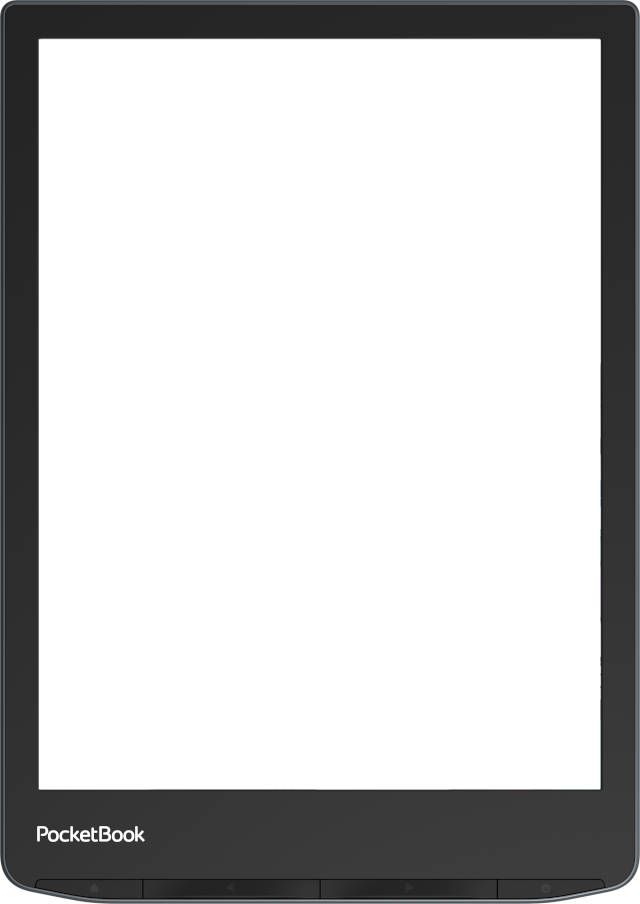
| Auflage: | 1. Auflage |
|---|---|
| Seitenanzahl: | 208 Seiten |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: | 2019 |
| Verlag: | Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG |
| ISBN: | 978-3-446-26522-6 |
Wer Rassismus bekämpfen will, muss Veränderung befürworten - und die fängt bei einem selbst an.
'Darf ich mal deine Haare anfassen?', 'Kannst du Sonnenbrand bekommen?', 'Wo kommst du her?' Wer solche Fragen stellt, meint es meist nicht böse. Aber dennoch: Sie sind rassistisch. Warum, das wollen weiße Menschen oft nicht hören.
Alice Hasters erklärt es trotzdem. Eindringlich und geduldig beschreibt sie, wie Rassismus ihren Alltag als Schwarze Frau in Deutschland prägt. Dabei wird klar: Rassismus ist nicht nur ein Problem am rechten Rand der Gesellschaft. Und sich mit dem eigenen Rassismus zu konfrontieren, ist im ersten Moment schmerzhaft, aber der einzige Weg, ihn zu überwinden.
Alice Hasters wurde 1989 in Köln geboren. Sie lebt und arbeitet als freie Autorin, Moderatorin und Speakerin in Berlin. Sie war unter anderem für die Tagesschau und das Jugendprogramm Funk tätig und entwickelte Social-Media-Formate für den RBB und Deutschlandfunk Nova. Mit Maxi Häcke spricht sie im monatlichen Podcast Feuer&Brot über Feminismus und Popkultur. Ihr erstes Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten belegte Platz 5 der Jahresbestsellerliste Sachbuch im Paperback 2020. Für ihre Bildungsarbeit zum Thema Rassismus wurde sie 2020 zur Kulturjournalistin des Jahres gewählt.
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
1 Alltag
Das R-Wort
Ich bin in Köln-Nippes aufgewachsen. Kölner*innen pflegen einen besonderen Patriotismus, wenn es um ihre Heimatstadt geht. Nippeser*innen legen noch einmal eine Schippe drauf. Sie lieben ihr Viertel. So sehr. Sie lassen sich die Nippeser Postleitzahl tätowieren und tragen T-Shirts und Mützen, die erkennen lassen, wo sie wohnen.
Als ich klein war, witzelte Stefan Raab im Fernsehen gerne darüber, dass Nippes ein hartes Pflaster sei. Das stimmte nicht. Zumindest nicht in meinen Augen. Es war das Lieblingsviertel von Künstler*innen und Freiberufler*innen. Die Mieten waren verhältnismäßig günstig, und trotzdem war es nicht ab vom Schuss. Viele Familien mit überwiegend türkischer Zuwanderungsgeschichte lebten dort. Rückblickend reichte das wahrscheinlich, um Nippes als ein Problemviertel darzustellen.
Auf dem Nippeser Markplatz thront ein hässlicher Betonklotz mit großen Treppenstufen, die nirgendwo hinführen. Was dieser Bau genau soll, wofür er gut ist, weiß ich bis heute nicht. Von dort aus kann man gut beobachten, wie mittags Menschen zwischen den Ständen hin und her wuseln und der Geräuschkulisse aus den Schreien der Verkäufer*innen und dem kölschen, nachbarlichen Gequatsche lauschen. Als ich jung war, spielten wir dort nach der Schule zwischen zermatschtem Gemüse. Im Sommer kauften wir uns für zwanzig Pfennige Wassereis und Kaugummis am kleinen Kiosk, setzten uns auf die nach Urin und Essensresten stinkenden Betonstufen und streckten uns gegenseitig unsere blau gefärbten Zungen entgegen.
Mittlerweile ist Köln-Nippes gentrifiziert.
Imbissbuden, Ramschläden und alteingesessene Kneipen mussten Burgerläden, Bars und Cafés weichen. Der hässliche Betonklotz auf dem Marktplatz wurde von einem lokalen Künstler bunt angemalt und sieht jetzt ein bisschen besser aus. Immerhin. Den Kiosk gibt es nicht mehr. Dort hat eine kleine Kaffeebude aufgemacht.
Als ich noch, einige Jahre älter inzwischen, in Nippes gewohnt habe, habe ich mich dort, an der Kaffeebude, oft mit meiner Freundin Luise getroffen. So saß ich mit Anfang zwanzig wieder gerne auf den Betonstufen, statt Wassereis einen Cappuccino in der Hand. Der Kaffeeladen wird von zwei Frauen betrieben, die Kund*innen mit einem Lächeln begrüßen und ihre Kaffees mit viel Liebe durch das Durchreichfenster übergeben.
Eines Tages, als Luise ihren Kaffee bezahlte und Trinkgeld geben wollte, stellte eine der Frauen eine Spardose vor uns. »Hier kannst du es reinschmeißen«, sagte sie vergnügt. Es war eine antike Spardose: der Oberkörper eines Schwarzen Mannes. Rote Lippen, breit zu einem absurden Lächeln geformt, große Augen und Nase. Vor seinem Mund eine Hand, in die man die Münze hineinlegen konnte. Als die Frau einen Hebel betätigte, hob sich die Hand. Die Augen des Mannes rollten nach hinten, die Münze verschwand in seinem Mund und landete scheppernd im Inneren der Spardose.
Ich hatte so eine Sparbüchse schon einmal gesehen. Meine Mutter hatte vor vielen Jahren eine weibliche Version in einem Antiquariat in Irland gekauft, als wir dort Urlaub machten. Damals war ich neun Jahre alt. Ich wunderte mich über diese seltsame Spardose. »Warum hast du sie gekauft?«, fragte ich meine Mutter. »Ich will nicht, dass jemand so etwas Rassistisches besitzt, deshalb muss ich sie aus dem Verkehr ziehen«, sagte sie. Sie erklärte mir auch, dass diese Spardose symbolisieren sollte, dass Schwarze das ganze Geld der Weißen verschlucken würden. Damals habe ich noch nicht genau verstanden, warum.
Heute weiß ich, dass diese Spardosen zwischen dem Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts sehr beliebt waren, »Jolly N**ger Bank« genannt wurden und aus den USA kommen. Nach der offiziellen Beendigung der Sklaverei 1865 dort, wurde jedem Schwarzen Menschen im Zuge einer Agrarreform sechzehn Hekt