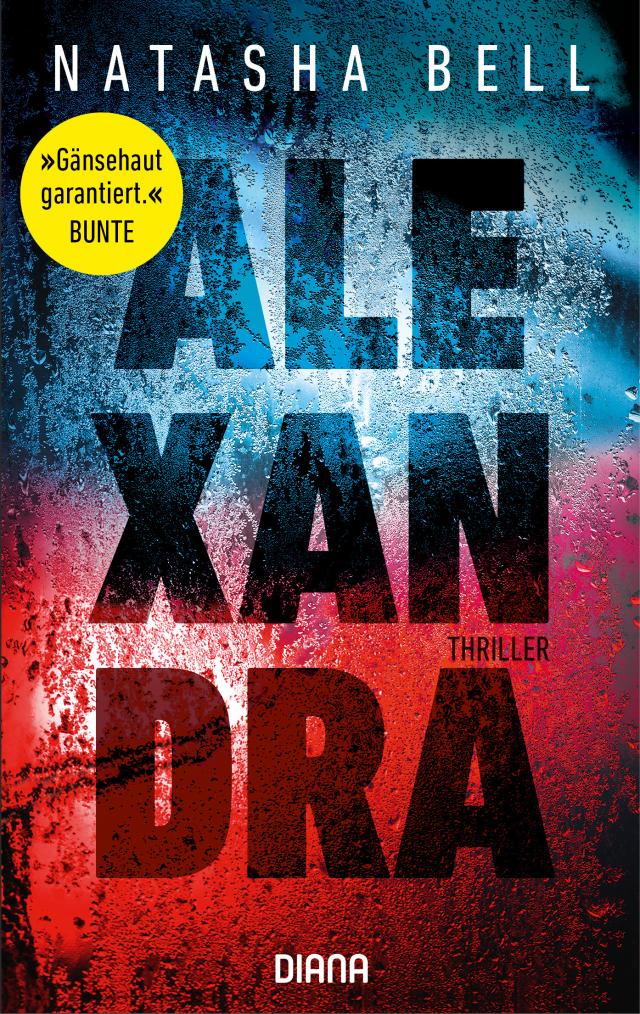
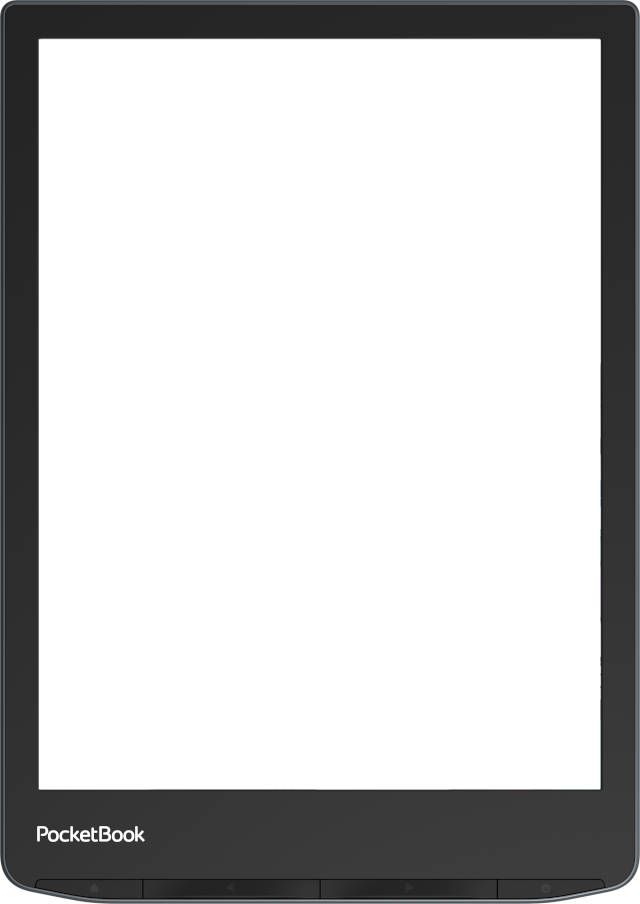
| Seitenanzahl: | 416 Seiten |
|---|---|
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: | 2019 |
| Verlag: | Diana Verlag; Michael Joseph |
| ISBN: | 978-3-641-21067-0 |
Zwölf Jahre ist es her, dass die junge Künstlerin Alexandra und Marc geheiratet haben. Seitdem ist sie eine liebende Ehefrau und Mutter zweier Töchter. Bis sie eines Tages spurlos verschwindet. Die Polizei findet nur ihre blutige Kleidung am Flussufer, und plötzlich wird aus der Vermisstensuche eine Mordermittlung. Doch Alexandra lebt. Weit weg von ihren Lieben wird sie gegen ihren Willen festgehalten. Verzweifelt muss sie auf Videos mitansehen, wie sich ihre Familie quält. Marc ist außer sich. Auf eigene Faust begibt er sich auf die Suche nach seiner Frau. Und die Geheimnisse, die er ans Licht bringt, machen eines deutlich: Niemand kennt Alexandra wirklich, nicht einmal er.
Natasha Bell ist in Somerset aufgewachsen und hat Englische Literatur an der Universität von York studiert. Sie hat außerdem einen Master in Creative Writing von der Goldsmith University London. Die Autorin lebt im Südosten von London.
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
DONNERSTAG, 21. FEBRUAR 2013
DER ANFANG
Marc saß auf der untersten Stufe und versuchte, nicht gleich das Schlimmste zu denken. Die Stimme fuhr fort: »Die große Mehrheit der Vermissten taucht unversehrt in den ersten achtundvierzig Stunden wieder auf, Mr. Southwood. Es gibt keinen Grund zur Panik.« Darauf folgte eine Pause. Marc wusste, das sollte ihn trösten. Einfach abwarten, bis seine Frau mit einer völlig schlüssigen Erklärung nach Hause käme.
Der Officer wünschte ihm einen guten Abend und legte auf. Als ob das Problem damit erledigt wäre. Als ob Marc sich damit besser fühlen würde.
Sechs Stunden vorbei, blieben zweiundvierzig.
Ich wünschte, ich könnte bei ihm sein. Ich würde erst die Arme und dann die Beine um ihn schlingen und mich an ihn klammern, bis wir die Balance verlieren und im Flur zu Boden fallen. Ihm mit meiner Berührung das zu verstehen geben, was er an dem Abend wissen musste: Ich bin hier. Gleich hier.
Er stand auf, unterbrach die Verbindung, legte den Hörer auf die Station und damit gleichzeitig seinen einzigen Plan, etwas zu unternehmen, ad acta. Seine Armhaare stellten sich auf, und er zitterte zum stummen Rhythmus von da stimmt was nicht, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht.
Vielleicht hätte er die Polizei nicht anrufen sollen. Schließlich bin ich eine erwachsene Frau. Vielleicht war es ein bisschen übertrieben, mich gleich als vermisst zu melden. Ich hatte doch keinen Hausarrest.
Aber ich war Mutter. Meine Kinder waren zu Hause und ich nicht. Das sieht ihr gar nicht ähnlich, hatte Marc vor einer Minute zum Officer gesagt. Dabei fühlte er sich, als würde er jammern; diese kindische Aussage war natürlich lächerlich, wenn man erklären wollte, wie absolut unnormal es war, dass eine Frau, die immer nach Hause kommt, Tag für Tag, Jahr für Jahr, an diesem Tag nicht heimkommt.
Ich hätte zu Hause sein sollen, als er mit den Mädchen vom Schwimmen kam. Wir hätten uns etwas zu essen bestellt. Dann hätten wir bei Chow mein zusammengesessen und uns über Alltägliches wie Tage der offenen Tür und Budgetkürzungen unterhalten.
Er versuchte noch einmal, mich anzurufen. Aus, wie immer. »Meine kleine Technikfeindin« nannte er mich immer, wenn er mich fragte, ob ich ein iPhone zum Geburtstag wolle, und ich darauf antwortete, ich sei völlig zufrieden mit meinem zwei Jahre alten Gerät. Damit konnte man telefonieren und E-Mails lesen - was wollte ich mehr? Vielleicht hätte er mich mehr damit triezen sollen. Jeder andere Mann hätte mir einfach eins geschenkt, unsere Kalender und Adressbücher synchronisiert und eine App heruntergeladen, mit der er mich überwachen konnte, damit ich nicht verloren ging.
»Es ist Donnerstag, Herrgott noch mal«, sagte Marc laut. Er ging zum Fenster und sah wieder auf die Straße. Ohne triftigen Grund würde ich unseren Donnerstagabend mit bestelltem Essen nicht verpassen.
Er kratzte sich an der linken Schläfe.
Dem Officer hatte er es zu erklären versucht. Hieß er Jones? Officer Jones glaubte, wir hätten uns gestritten. Ständig verschwanden Menschen.
Ich allerdings nicht.
Ich hatte den Tag bei der Arbeit verbracht. Marc hatte meine Kollegin Paula angerufen und sich bei ihr erkundigt. Sie sagte, sie sei mit mir zusammen aus dem Gebäude gegangen. Ich hätte ihr ein schönes Wochenende gewünscht, da sie Freitag wegen einer Hochzeit im Familienkreis Urlaub habe. Sie werde sich bemühen, hatte sie geantwortet, weil sie solche Veranstaltungen nicht leiden könne, und zum Abschied hätten wir uns zugewinkt.
Seit dem Gespräch waren mehrere Stunden vergangen. Jetzt war es dreiundzwanzig Uhr. Draußen war es dunkel.
Bei solchen Vorkommnissen machte sich mein Mann Sorgen. Dabei spielte es keine Rolle, dass ich vor unserem Kennenlernen allein gelebt hatte. Auch nicht, dass ich über ein Jahr durch die Straßen von Chicago geschlendert wa